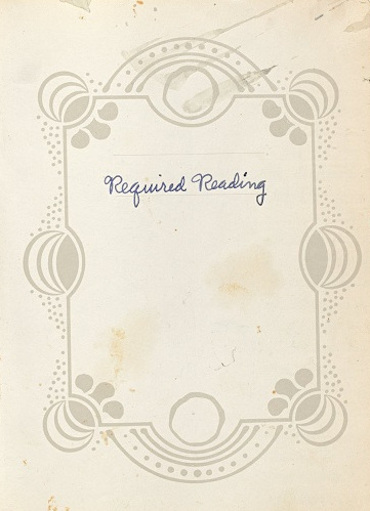Required Reading
Ein Notizheft des amerikanischen Künstlers Paul Thek in der Sammlung von Kolumba trägt den Titel Required Reading (Pflichtlektüre). Im Inneren finden sich längere und kürzere Zitate aus unterschiedlichen, meist philosophisch-spirituellen Texten, vom Künstler handschriftlich festgehalten und über die Zeiten hinweg gesammelt. Diese Idee einer subjektiven Sammlung von besonders wichtigen Texten greifen wir auf: Wir laden monatlich Gäste ein, einen Text mitzubringen, der ihnen besonders am Herzen liegt und den zu lesen sie uns hier und heute empfehlen. Required Reading stellt also keinen (neuen) Kanon der Pflichtlektüren auf; vielmehr laden wir dazu ein, ausgelegten Spuren zu folgen und die eigene Leseerfahrung im Austausch mit dem jeweiligen Gast und anderen Besucher*innen einzubringen. Required Reading findet immer am zweiten Donnerstag im Monat statt, jeweils von 17:30 bis 19 Uhr. Die Veranstaltung wird von unserem Gastkurator Andreas Speer (Professor für Philosophie an der Universität Köln) konzipiert und jeweils von den wechselnden Gästen moderiert. Der Eintritt ist frei. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft zur vorausgehenden Lektüre. Wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine Mail an ticket@kolumba.de. Sie bekommen den Text dann als PDF zugeschickt.
Donnerstag 11. Januar, 15. Februar, 14. März, 11. April, 13. Juni, 11. Juli, 8. August 2024
11. Januar, 17.30 Uhr
Christian Feldbacher-Escamilla: Julio Cortázar, Rayuela, erschienen 1963, auf Deutsch 1981
Der argentinisch-französische Schriftsteller Julio Cortázar (1914–1984) hat wesentlich zur Etablierung eines weltweiten Interesses an lateinamerikanischer Literatur beigetragen. Seine Werke sind gefüllt mit und geleitet von philosophischen Fragestellungen. Er selbst hat sein Hauptwerk Rayuela als »metaphysischen Roman« bezeichnet, in welchem die Hauptcharaktere auf der Suche nach dem Wesentlichen sind. Dem Wesentlichen und Notwendigen steht das Zufällige, das Kontingente entgegen. Dieses Spannungsfeld zwischen Notwendigkeit und Zufall durchleben nicht nur die Protagonist*innen des Romans, sondern auch wir auf vielfältige Weise. Wir können vermuten, dass mit dem Schwinden von Autoritäten im Sinne der Aufklärung dieses Spannungsfeld gewachsen ist und – wie vielleicht die vielen Polarisierungen unserer Zeit nahelegen – aktuell an eine Grenze des Zerreissens gelangt ist. Cortázar schlägt zwei verschiedene Möglichkeiten vor, den Text zu lesen: fortlaufend und sprunghaft. Diese Möglichkeit der alternativen Texterschließung legt die Frage nahe, was denn die »Essenz« des Werkes ist; ob man überhaupt von nur einem Werk oder ob man von mehreren sprechen sollte; und auch ob ein und demselben Individuum tatsächlich beide Möglichkeiten der Texterschließung offen stehen. Diese Metaperspektive von den Inhalten des Romans/der Romane auf den Roman/die Romane macht den Text besonders interessant für eine gemeinsame Erschließung.
15. Februar, 17.30 Uhr
Andreas Speer: Sarah Stroumsa, Das Kaleidoskop der Convivencia. Denktraditionen des Mittelalters im Austausch zwischen Islam, Judentum und Christentum, Freiburg 2023 (Ausschnitt)
Im
vergangenen Jahr erschien ein Buch von Sarah Stroumsa, emeritierte
Professorin für Arabistik an der Hebrew University Jerusalem, dessen
Titel Programm ist: Das Kaleidoskop der Convivencia. Denktraditionen des
Mittelalters im Austausch zwischen Islam, Judentum und Christentum. Das
Anliegen dieses Buches ist eine neue, integrative Darstellung
verschiedener philosophischer und theologischer Traditionen in der
islamischen Welt des 7. bis 15. Jahrhunderts, die sich von den
Mittelmeerregionen, der Levante bis zu den Ländern des Indischen Ozeans
erstreckt. Diese Convivencia (=Zusammenleben) – das ist die Botschaft
dieses Buches – war nicht nur eine theoretische Idee, sondern gelebte
Wirklichkeit.
14. März, 17.30 Uhr
Christoph Helmig: Peter Handke, Versuch über den geglückten Tag, 1991
Peter Handkes Versuch über den geglückten Tag (1991) ist einer von insgesamt fünf Versuchen, in denen er sich Phänomenen des Alltags beschreibend nähert (Glück, Müdigkeit, die Jukebox, der „stille Ort“ und der Pilznarr). Das Buch steht in der Tradition antiker Diskussionen über das Glück oder die Glückseligkeit (eudaimônia) und eröffnet bereits mit dem Motto aus Paulus‘ Brief an die Römer („Der den Tag denkt, denkt dem Herrn“, 14.6) eine theologische Dimension des Nachdenkens über das Glück(en). Für den Erzähler, das wird schnell deutlich, ist das Tagwerk eng verbunden mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Allerdings impliziert jeder Versuch auch die drohende Möglichkeit des Scheiterns …
11. April, 17.30 Uhr
Miriam Rogasch: Miranda Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit. Macht und die Ethik des Wissens, erschienen 2007 (auf Deutsch 2023)
Frickers Werk, das unter dem englischen Originaltitel Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing bereits
2007 erschienen ist, ist 2023 auch ins Deutsche übersetzt
veröffentlicht worden. Die Erscheinung der deutschen Übersetzung möchten
wir zum Anlass nehmen, den von ihr geprägten Begriff der „epistemischen
Ungerechtigkeit“ zumindest in einer der beiden Ausformungen, die sie
identifiziert, nämlich der der Zeugnisungerechtigkeit (testimonial
injustice), näher zu betrachten.
Was Frickers Werk zu einem required reading macht,
ist vor allem der unbestreitbare Erfolg der Begriffsprägung. Seit
Erscheinen des Werkes scheint kein Weg mehr an diesem Begriff
vorbeizuführen, den es vorher gar nicht gab: Es hat unzählige Artikel
und Forschungsprojekte zum Thema der epistemischen Ungerechtigkeit
gegeben und gibt sie weiterhin, der Begriff wurde auch auf Felder
angewendet, die bei Fricker selbst, deren Fokus vor allem auf Rassismus
und Sexismus liegt, noch keine Erwähnung finden, etwa den Bereich der
Neurodiversität und der Medizin. Angesichts dieses Erfolges scheint es
angebracht, sich auf den Ursprung zurückzubesinnen und zu fragen, wie
Fricker selbst genau die epistemische Ungerechtigkeit definiert und mit
welcher Motivation sie dies tut. Was sind die Kriterien dafür, dass
epistemische Ungerechtigkeit vorliegt? Warum ist die Überschneidung von
epistemologischen und ethischen Elementen so zentral? Sollte der Begriff
angesichts veränderter Medien- und Kommunikationsformen heute angepasst
werden? Das Gespräch wird moderiert von Miriam Rogasch, Mitarbeiterin
am Kölner Thomas-Institut.
13. Juni, 17.30 Uhr
Andreas Maier: Halldór Laxness, Am Gletscher (Deutsche Ausgabe 1998, Ausschnitte)
Der junge Theologe Vebi wird als Vertreter des Bischofs in eine abgelegene Gemeinde am Fuße des Snaefellsgletschers im äußersten Westen Islands geschickt. Er soll dort mit einem Tonbandgerät Berichte über merkwürdige Vorgänge untersuchen. Der örtliche Pfarrer, Sira Jón Jónsson, repariert offenbar weder die Kirche, noch tauft er Kinder oder bestattet die Toten. Seit 20 Jahren hat er sein Gehalt nicht mehr abgeholt. Stattdessen repariert er Gerätschaften und beschlägt Pferde. Seine Frau ist seit 30 Jahren verschollen. Am Gletscher angekommen, fällt es Vebi schwer, die Gespräche und Vorgänge um den Pfarrhof zu verstehen. Professor Dr. Godman Syngmann kommt mit drei Gehilfen, um eine Kiste vom Gletscher zu holen und – wie er sagt – durch astrochemische Zeremonien Leben zu erzeugen. Gleichzeitig mit Professor Syngmann erscheint Ua Am Pfarrhof, bei der es sich wohl um die verschollene Frau des Pfarrers handelt… Am Gletscher beleuchtet in unaufgeregter Sprache Grundfragen des Lebens und lässt darüber eine Art nicht-dokumentierbarer Wahrheit ahnbar werden.
11. Juli, 17.30 Uhr
Gabriella Cianciolo Cosentino: Lukrez – De Rerum Natura / Über die Natur der Dinge
Während die griechischen und lateinischen Klassiker immer mehr aus unseren Bücherregalen (und leider auch aus den Lehrplänen) verschwinden, bleibt die Lehre der Meisterwerke aus der Antike aktueller denn je. Wie kann ein Text, der vor 2000 Jahren geschrieben wurde, heute noch modern sein? Das ist der Fall von Lukrez‘ De Rerum Natura, einem Lehrgedicht aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., das im 15. Jahrhundert in einem deutschen Kloster entdeckt wurde. Dieses Werk von beeindruckender Aktualität und Intensität gilt als eines der einflussreichsten Schriften der Menschheitsgeschichte. Anhand ausgewählter Auszüge werden wir den Kosmos, das Leben und die ‚Natur der Dinge‘ mit den Augen des römischen Dichters und Philosophen betrachten, über den kaum etwas bekannt ist und der seit Jahrhunderten Intellektuelle, Künstler und Wissenschaftler weltweit fasziniert.
8. August, 17.30 Uhr
Eric Eggert: Michael Hardt & Antonio Negri, Empire, 2000 (Ausschnitt)
Mit ihrem Buch Empire
legten Hardt und Negri im Jahr 2000 eine Analyse des postmodernen
Kapitalismus vor, die nicht nur der globalisierungskritischen Linken der
darauffolgenden Jahre eine Reihe von theoretischen Werkzeugen und
Begriffen zur Verfügung stellte, sondern auch auf eine breite Resonanz
in den sozialen Bewegungen wie Occupy Wall Street traf. Dies war
vielleicht nicht zuletzt dem prophetischen Unterton geschuldet, der den
sozialen Kämpfen eine aussichtsreiche Position versprach. Nach über 20
Jahren muss konstatiert werden, dass sich diese Hoffnung (noch) nicht
erfüllt hat. Dennoch, oder gerade deshalb, bietet sich in unserer von
diversen, miteinander verwobenen Krisen geprägten Zeit eine kritische
Überprüfung der Thesen von Empire an. Wir widmen uns in unserer
gemeinsamen Lektüre dem vierten Teil des Buches, der unter der
Überschrift „Untergang und Fall des Empire“ Fluchtlinien aus der
kapitalistisch geprägten Globalisierung heraus skizziert und dazu
einlädt, über gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu reflektieren.